Wissenschaft mit Spaß und Begeisterung zugänglich machen

Die Molekularbiologin Julia Offe kann für sich in Anspruch nehmen, die Wissenschaftskommunikation in Deutschland entscheidend belebt zu haben. Mit dem zuvor weitgehend unbekannten Format der „Science Slams“ holte sie die Wissenschaft aus den Laboren auf die Bühne. Denn – so die Idee – Forschungsthemen witzig und unterhaltsam in zehn Minuten vor Publikum zu präsentieren, kann durchaus helfen, auch wissenschaftsferne Mitmenschen für Forschung zu begeistern. Science Slams gibt es mittlerweile in der ganzen Republik und zum Glück finden sich mittlerweile auch genug Wissenschaftler, die hier gerne mitmachen. Denn - so erzählt uns Julia Offe – für ihren ersten Science Slam im Jahr 2009 war es gar nicht so einfach, geeignete und willige Teilnehmer zu finden.
Und so sprechen wir in dieser Folge über Didaktiker, die nicht präsentieren können, über die Schwierigkeit, Wissenschaft witzig und gleichzeitig fundiert zu präsentieren, über Globuli und die GWUP, und warum gute Wissenschaftskommunikation dabei helfen kann, antiwissenschaftliche Scharlatane in Schach zu halten.
Verwandte Episoden
Sie möchten diese Ausgabe von Forschergeist anderen empfehlen? Hier können Sie sich ein einfaches PDF mit einer Inhaltsangabe der Sendung herunterladen und diese dann für ein schwarzes Brett ausdrucken oder auch per E-Mail weiterleiten.

Transkript

















































































































































































































































































Shownotes
Glossar
Science Slam
Poetry Slam
Anthroposophie
Heinz Sielmann
Bernhard Grzimek
Biowissenschaften
Pecha Kucha
Prompter
Krill
Large Hadron Collider (LHC)
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP)
Impfung
Globuli
Homöopathie
James Randi
Uri Geller
Gott
Kreationismus
Bologna-Prozess
Intelligent Design

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

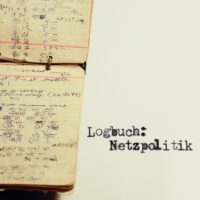



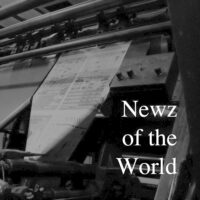

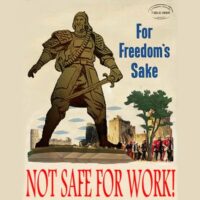










Vielen Dank für die sehr hörenswerte Folge. Eine kurze Ergänzung zu der Frage, ob es Science Slams auch schon als Format der internen Kommunikation von Wissenschaftsorganisationen gegeben hat – ja: Das DLR hat das 2012 mit regionalen Vorausscheidungen und einem Finale bei seiner Jahreskonferenz gemacht. Einen PR-Preis gab es dafür auch.
Pingback: „Forschergeist“-Podcast: Julia Offe über Science Slams, Globuli und die GWUP @ gwup | die skeptiker
Schöne Folge, wieder sehr hörenswert!
Bei allen Fortschritten, die wir der Entwicklung von Impfstoffen zu verdanken haben, hat Frau Offe leider eine etwas unreflektierte Meinung zum Thema Impfen und stempelt Eltern, die ihre Eltern nicht impfen, sehr rigide ab. Schade, das habe ich anders erwartet…
„Sie müssen nicht alle Ihre Kinder impfen lassen – nur die, die Sie behalten wollen.“ (Quelle: Twitter)
Ein sehr trefflicher Beitrag zur Szene dieser „Skeptiker“ findet sich hier:
http://www.skeptizismus.de/skepreview.pdf
Wenn man Science Slams schon vorwirft Wissenschaft zu trivialisieren, dann muss man sagen, dass die GWUP in weiten Teilen einem arg antiquierten und banalen Wissenschaftsbild nachhängt… Naiver Realismus, Positivismus, bestenfalls noch Karl Popper und die 30er Jahre.
Super Sendung!
Gibt es einen einen ähnlichen Podcast, der hauptthematisch über das Thema Homöopathie / Zuckerkügelchen / Placebo etc. geht ?
Auch über die „Untersuchungen“ mit Messungen etc. ?
Vielen Dank für die interessante Sendung!
Gegen Ende habt Ihr nach dem Grund für die zunehmende Wissenschaftsferne der Menschen und den starken Zulauf zu diversen esotherischen Heilslehren gefragt. Den gegebenen Antworten würde ich gern noch etwas hinzufügen.
Heute haben wir eine Informationsflut, die für einzelne nicht mehr zu erfassen ist, schon allein über die Werbungsmassen „hinweg zu sehen“ ist anstrengend… Der Handlungsrahmen von Wirtschaft und Politik ist global geworden. Beides kann Gefühle von Ohnmacht oder Hilfslosigkeit auslösen.
Ich denke, Menschen brauchen einen klaren Orientierungsrahmen, der hilft, Informationen zu sortieren.
Eure generelle Religionskritik kann ich nicht teilen. Ich kenne viele aufrechte Christenmenschen (Protestanten), die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Ihr Glauben gibt Ihnen viel Kraft dazu. Religiöse Texte werden nicht(!) wörtlich genommen, es handelt sich vielmehr um Allegorien. Viele können Ihren Glauben sehr gut mit hohen wissenschaftlichen Positionen verbinden und haben ein weitgefasstes Gottesbild, das Gott auch mit Wahrheit oder Liebe gleichsetzt. Ähnliche Freigeister gibt es selbstverständlich auch in anderen Religionen!
Sicherlich, die Geschichte der Kirchen ist z.T. schrecklich (Mittelalter-Ketzerei/Luther-Antijudaismus/Frauenbild…), wird in diesen Kreisen aber reflektiert betrachtet und bearbeitet. Ein „abgehangenes“ moralisches Wertesystem, das verschiedene Zeiten und Krisen durchlebt hat, kann auf jeden Fall Halt bieten und vor Sekten, Heilslehren etc. schützen.
Die Entwicklung in Amerika finde ich auch besorgniserregend. Jeglichen Fanatismus lehne ich ab.
Noch ein Wort zum „Gebet“, das bei Euch auch kritisiert wurde (Nebensatz). Was spricht z.B. gegen weltweite ev. sogar religionsübergreifende Friedensgebete? Auch die Psychologie hat die Macht von positiven Gedanken längst bestätigt. Es handelt sich ja um eine postive Ausrichtung des eigenen Geistes ist, die entsprechende Handlungen nach sich zieht. Die Dynamik von „gleichgeschalteten“ Massen ist aus positiven wie negativen Beispielen hinlänglich bekannt. Warum dies nicht in den Dienst einer guten Sache stellen? Bei der friedlichen Revolution von `89 haben Friedensgebete eine wichtige Rolle gespielt, die Bewegung um Gandhi wäre ein weiteres Beispiel…
Achtung Provokantes/Polemisches:
Ist nicht auch die Wissenschaft eine Art von Glauben? Das Gleichsetzen des momentanen wissenschaftlichen Kenntnisstandes mit absoluten Wahrheiten und daraus abgeleitetem Handeln hat in der Geschichte auch schreckliche Blüten getrieben: den Sozialdarwinismus im Dritten Reich (ein Podcast darüber wäre toll!), Bereiche der Medizin im 18./19. Jh…
Faust:
“Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar
Und ziehe schon an die zehn Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum-
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen,
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel-
Dafür ist mir auch alle Freud entrissen,
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,
Die Menschen zu bessern und zu bekehren.”
;-)
Ansonsten teile ich das Gesagte. Es braucht Freigeister: Menschen, die zum Nachdenken und zum Diskurs anregen!
Danke nochmal!!
Sehr schöne Folge! Vielen Dank an euch beide!