Ein Blick auf das akademische System in England


Ulinka Rublack |
Das akademische System in Deutschland unterscheidet sich in Anspruch und Umfang teilweise deutlich von der universitären Realität in Großbritannien. An den Eliteuniversitäten in Cambridge und Oxford herrschen deutlich andere Kulturen. Doch was lässt sich aus einem Vergleich lernen? Während das auf ein breites Bildungsangebot ausgelegte deutsche System auch Empfehlungen für Großbritannien bereithält, lassen sich auch einige interessante Aspekte aus Cambridge auf Deutschland übertragen.
Wir sprechen mit Ulinka Rublack, Professorin für frühneuzeitliche Geschichte Europas im St. John's College an der Universität Cambridge. Sie hat früh in ihrem Studium bereits einen Blick nach England gewagt und ist nach Abschluss des Studiums komplett nach Cambdrige gewechselt.
Verwandte Episoden

Transkript











































































































































Shownotes
Links
Glossar
Frühe Neuzeit
Historische Anthropologie
Peter Burke
Robert Scribner
Hans-Ulrich Wehler
Evangelisches Studienwerk Villigst
Emmanuel Levinas
Martin Warnke
Horst Bredekamp
Monika Wagner
Annales-Schule
Master of Philosophy (M. Phil)
Akademischer Mittelbau
Drittmittel
Monografie
Leonberg
Cricket
Croquet
Serendipität
Philip Glass
Kepler
Paul Hindemith
Die Harmonie der Welt
Timothy Watts

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License







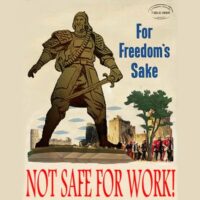








Ganz interessant dazu die gerade in der ARD-Mediathek abrufbare Dokumentation „Die Illusion der Chancengleichheit“, wo die Ungerechtigkeit des deutschen universitären Systems beklagt wird: http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Die-Illusion-der-Ch/Das-Erste/Video?documentId=30334000&bcastId=799280
Was ich nicht so ganz verstehe, wenn man mal nach OECD-Vergleichsdaten zur „tertiary education“ schaut, scheint das Vereinigte Königreich so bei 40% zu liegen, während Deutschland nur bei 30% ist. Unterscheiden sich die britischen Universitäten jenseits von Oxford und Cambridge also überhaupt so sehr von den deutschen, wenn sie auf anteilig vergleichbare bzw. höhere Abschlusszahlen kommen?
Pingback: [Stifterverband] Podcast: Forschen und Lehren in Cambridge
Beim Hören enstand der Eindruck, dass viele Studierende gar nicht Geschichte aufgrund des Inhalts, erst recht nicht aufgrund der Forschung, studieren wollen. Zwar erwirbt man durchaus Fertigkeiten (z.B. Textanalyse, Präsentieren, …), doch zielgerichtet für das spätere Berufsleben wird nicht studiert.
Liegt dies daran, dass es irrelevant ist, d.h. der Ruf der Universität allein eine Jobgarantie ist?
Oder besteht trotz der derzeitigen gesellschaftlichen Norm, eine „gute“ Universität als Voraussetzung für einen Job zu besuchen, die Idee der universellen Bildung?
Inwieweit spielt der Studiengang eine Rolle für das Berufsleben?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
mir sind 2 Sachen aufgefallen:
– das Konzept „Elite“ wurde kritiklos angenommen, obwohl das Thema Geld doch angeklungen ist. Wie kann man wirklich sicher sein, die echte Elite zu bekommen, wenn im Vorfeld sehr teurer Privatschulen quasi Voraussetzung sind, um aufgenommen zu werden?
– offenbar wird „irgendwas“ studiert, Hautsache Oxbridge. Danach macht man (so habe ich es verstanden) eine „Umschulung zum Juristen“, um viel Geld zu verdienen. Komisch, dass man in D fast 10 Jahre lang Jura studieren muss, und in England umgeschulte Kunsthistoriker den Job machen!