Ein Blick in die Vergangenheit und Zukunft der Wissenschaft


Annette Vogt |
Forschergeist ist eine Serie von Gesprächen, die die Arbeit von Wissenschaftlern und das Wesen des Wissenschaftssystems näher bringen soll. Die erste offizielle Podcast-Folge spannt einen weiten Bogen und erzählt die Geschichte der Wissenschaft: Wer war eigentlich der erste Wissenschaftler? Und was unterscheidet die Forschung in der Antike und im Mittelalter von unserer heutigen? Annette Vogt vom Max-Planck-Instititut für Wissenschaftsgeschichte weiß die Antworten.
Verwandte Episoden

Transkript

















































































































































































































Shownotes
Links

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

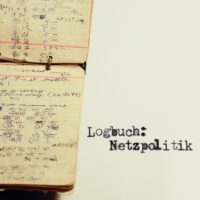



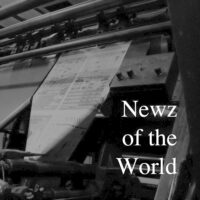

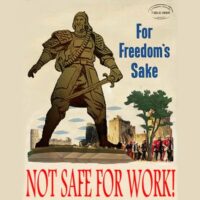







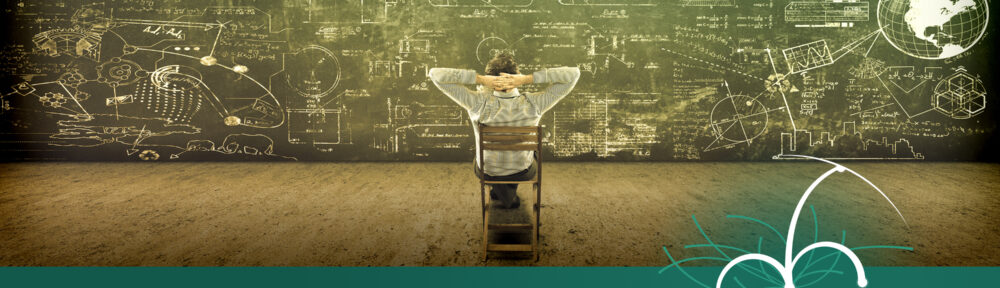
Oh, neues aus der Metaebene :-)
Und dann noch so ein vielversprechendes Thema – wird gleich abonniert, ich freu mich drauf!
Interessanter Einstieg, wobei mich gerade einige der angedeuteten aber nicht weiter vertieften Themen neugierig gemacht haben.
Wie Wissenschaft oder vielleicht auch Wissen an sich in nicht-europäischen Kulturen in der Vergangenheit (gegebenenfalls mit Auswirkungen bis heute) verstanden wurde, würde ich mich als Folgethema sehr interessieren.
Und wenn sich bei der Frage der Wissenschaftssprache ein Gesprächspartner finden würde, fände ich es interessant der Rolle verschiedener Wissenschaftssprachen in der Vergangenheit nachzugehen und wie sie wissenschaftliches Verständnis geprägt haben. Latein wurde ja genannt. Aber auch vor hundert Jahren waren Deutsch und Französisch mit Englisch als Wissenschaftssprache ja durchaus noch auf einer Höhe. Beim Hochchinesischen heute habe ich den Eindruck, dass durch die Größe der Sprechergemeinschaft und ihre teilweise Abschottung, sowie die starke Entwicklung der wissenschaftlichen Institutionen in der Volksrepublik ein bisschen eine lokale Konkurrenzsprache zum Wissenschaftsenglisch entsteht. Und natürlich spielen für viele kulturwissenschaftliche Disziplinen die lokalen Sprachen eine große Rolle.
Ich weiß natürlich nicht, inwiefern diese Themen in den Podcast passen…
Danke für die Anregungen. In der Tat wäre es interessant, unseren europäischen Blick hie und da mal etwas zu weiten.
Zum Thema Wissenschaftssprache haben wir schon etwas in Planung…
Guten Tag!
Vielen Dank für diese sehr gedanklich sehr anregende Podcastepisode :-)
Zum Thema Eurozentristik würde mich interessieren, ob Sie von einer Dunkelziffer von Kontakten zwischen europäischen und fernöstlichen Kulturen ausgehen? Beim Thema Wissenschaftler der Antike hatten Sie ja diese Vermutung angeführt. Kann man im Umkehrschluss sagen, dass Euro-(sowie Sino-, Indo-, etc.)-Zentristik jeweils angemessen ist, wenn es nur sehr wenig Austausch gegeben haben mag?
Viele Grüße vom Bodensee!
PS an alle: Zur Frage wer zuerst Wissenschaft betrieb, erschien kürzlich ein Buch, dass Aristoteles an den Beginn (nicht nur) der Biologie setzt: The Lagoon von Armand Marie Leroi. Interviews & Besprechungen dazu:
http://onpoint.wbur.org/2014/09/29/aristotle-science-philosophy-greece
http://www.nature.com/nature/podcast/index-2014-09-04.html
http://www.theguardian.com/science/audio/2014/aug/11/science-weekly-podcast-aristotle-armand-leroi-lagoon
Der Podcast beginnt schonmal vielversprechend.
An Frau Vogt:
Ein kleiner Einspruch: Ich hielte reine „Lehrprofessuren“ – es müssten nicht einmal Professoren sein – gerade für die breiten Grundvorlesungen für absolut sinnvoll. Besonders für die Mathematikvorlesungen, die zum Standardprogramm für viele Studiengänge gehören (der klassische Analysis 1/2 + Lineare Algebra 1 oder Höhere Mathematik 1-3 Zyklus). Gerade diese Vorlesungen belasten die mathematischen Fakultäten in der Lehre enorm und führen zu viel zu grossen Veranstaltungen (ich sass damals mit 800 anderen Studenten in Lineare Algebra 1). Gleiches gilt für Statistik oder Programmierausbildung (Python, C++). Gerade das funktioniert in den USA sehr gut.